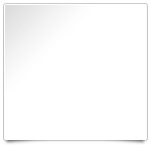1. Korrigieren Sie bitte den folgenden Text. Er enthält zwölf inhaltliche Fehler.
Unterstreichen Sie mit rotem Stift die falschen Aussagen und nummerieren Sie sie
fortlaufend. Stellen Sie unterhalb des Textes die Fehler richtig.
Prüfen Sie die folgenden Aussagen und schreiben Sie „richtig“ oder „falsch“ hinter
die Sätze!
Nennen Sie mindestens drei Grundprinzipien, an denen sich eine freiheitliche
Demokratie erkennen lässt.
b) Erklären Sie mit eigenen Worten möglichst knapp die Begriffe:
Grundrechte, repräsentative Demokratie, Plebiszit
Bearbeiten Sie die Karikatur „Die Macht des Wählers“ unter folgenden Gesichtspunkten:
a) Was ist auf der Karikatur dargestellt?
b) Was will der Zeichner ausdrücken, wenn er die gleiche Person in verschiedenen Größen zeichnet? Welche politische Aussage macht er und was kritisiert
er?
c) Welche Tatsachen des politischen Lebens in Deutschland sprechen für, welche
gegen die Kritik des Zeichners?
d) Stimmen Sie der Aussage des Zeichners zu, teilweise zu oder gar nicht zu?
Bitte begründen Sie ausführlich Ihre Meinung.
5. Das Grundgesetz hebt die politischen Parteien gegenüber anderen Vereinigungen
von Bürgern in Deutschland ausdrücklich hervor. Stellen Sie dar:
a) Welche Privilegien (Vorrechte) genießen politische Parteien in Deutschland, die
andere Vereinigungen nicht haben?
b) Welches sind die besonderen Aufgaben, die politische Parteien in unserem
Staat zu erfüllen haben? Geben Sie mindestens zwei Beispiele.
c) Wie beurteilen Sie selbst die Rolle der Parteien in Deutschland? Nehmen Sie
in diesem Zusammenhang begründet Stellung zu einer Feststellung des ehemaligen Bundestagspräsidenten Thierse (SPD): „Ja zur Demokratie sagen,
aber nein zu den Parteien, ist nicht möglich.“
6. Der deutsche Philosoph JASPERS schrieb vor über 40 Jahren über die Verfassung
der Bundesrepublik Deutschland: ...
a) Wie wird die Form von Demokratie genannt, die Jaspers 1966 kritisierte?
b) Prüfen Sie, ob sich an dem von Jaspers kritisierten Zustand seit 1966 etwas
geändert hat, ggf. in welchem Umfang. Geben Sie Beispiele.
c) Nennen Sie mindestens zwei Argumente, die gegen einen Ausbau der Formen
direkter Demokratie (z. B. Volksentscheid oder Referendum) auf Bundesebene
vorgetragen werden und setzen Sie sich mit diesen Argumenten auseinander.
d) Geben Sie abschließend eine begründete eigene Stellungnahme zu der angesprochenen Problematik ab.
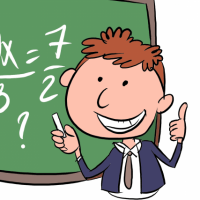 2.99
2.99
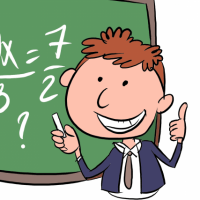 2.99
2.99
 Bewertungen
Bewertungen
 Benötigst Du Hilfe?
Benötigst Du Hilfe?
 Was ist StudyAid.de?
Was ist StudyAid.de?
 Rechtliches
Rechtliches
 Mehr von franiboe
Mehr von franiboe


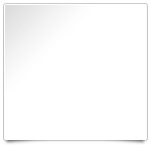;)