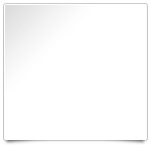1.a) Geben Sie die allgemeine Formel für die Berechnung der Impedanz einer Reihenschaltung aus R, L und C an. Anschließend berechnen Sie die komplexe Impedanz ZRCL-Reihe und geben das Ergebnis in Komponentenform an.
b) Welche 3 Winkelfunktionen kennen Sie, um den Winkel φ ermitteln zu können?
c) Wandeln Sie das Ergebnis aus a) schriftlich in die Eulerform um und nutzen Sie die Tangensfunktion, um φ zu ermitteln.
d) Wandeln Sie das Ergebnis aus a) in Polarform um.
e) Welchen Wert hat die Resonanzfrequenz?
f) Der Wert von C steigt um 10 %, der der Spule fällt um 20 %. Wie groß sind nun beide Blindwiderstände und welchen Wert hat nun die Resonanzfrequenz?
g) Welchen Einfluss hat der ohmsche Widerstand R auf die Resonanzfrequenz der Schaltung?
h) Wie wird der Reihenschwingkreis umgangssprachlich noch bezeichnet und warum?
2. a) Die Resonanzfrequenz liegt bei 45 kHz. Welchen Wert muss dann L circa haben?
b) Zeichnen Sie skizzenhaft (also qualitativ, ohne Skallierung der Achsen usw.) den Impedanzverlauf eines RCL-Reihenschwinkreises und kennzeichnen Sie die Stellen, an der die Resonanz wirksam ist und wo der Schwingkreis sich ohmsch-induktiv und ohmsch-kapazitiv verhält.
c) Zeichnen Sie in b) ebenfalls den Stromverlauf ein, sodass ein Zusammenhang beider Kurvenverläufe deutlich wird.
d) Nennen Sie ein Einsatzgebiet von Reihenschwingkreisen in der Elektrotechnik.
3. Eine Parallelschaltung ist gegeben mit R = 100 Ω, C = 47 µF und L = 80 mH.
a) Zeichnen Sie die Schaltung schematisch auf und berechnen Sie mithilfe der Bauteilwerte die Resonanzfrequenz fr des Schwingkreises.
b)Skizzieren Sie qualitativ den Impedanzverlauf ZRCL-Parallel über die Frequenz und kennzeichnen Sie den Bereich, in dem die Gesamtimpedanz sich überwiegend ohmsch-induktiv und ohmsch-kapazitiv und rein ohmsch verhält.
c) Wie sieht qualitativ der Verlauf des Gesamtstromes über die Frequenz aus? Zeichnen Sie diesen in die Skizze von b) mit ein.
d) Berechnen Sie ZRCL-Parallel der Schaltung für f1 = 47 Hz, f2 = 82 Hz und f3 = 119 Hz und stellen das Ergebnis in kartesischer als auch in Eulerform dar.
e) Wie wird der Parallelschwingkreis umgangssprachlich noch bezeichnet und warum?
f) Nennen Sie ein Einsatzgebiet von Parallelschwingkreisen.
4. a) Zeichnen Sie skizzenhaft vier mögliche Filter und kennzeichnen Sie jeweils, ob es sich um einen Hoch- oder Tiefpassfilter handelt.
b) Wie kann die Grenzfrequenz allgemein bei RL- und wie bei RC-Gliedern (also Filtern) formelmäßig ermittelt werden?
c) Wie wird die Grenzfrequenz umgangssprachlich noch bezeichnet? d) Welche beiden Aussagen können bei Erreichen der Grenzfrequenz allgemein gemacht werden?
e) Welcher Wert in db (Dezibel) liegt bei Grenzfrequenz vor?
f) Wie wird die grafische Darstellung der Übertragungskennlinie (stellt das Verhältnis von Aus- zum Eingang in Abhängigkeit der Frequenz dar) von Filtern bezeichnet?
5.a) Welcher Filtertyp liegt vor und warum?
b) Berechnen Sie die Grenzfrequenz des Filters.
c) Was passiert oberhalb der Grenzfrequenz am Ausgang der Schaltung?
6. a) Welchen Wert muss L haben, wenn eine Grenzfrequenz von 899 Hz vorliegen soll?
b) Welcher Spannungswert kann bei Grenzfrequenz an R abgegriffen werden, wenn die Eingangsspannung eine Amplitude von 14 V besitzt?
c) Berechnen Sie mithilfe der Spannungsteilerregel den effektiven Spannungsfall an R für f = 1,4 kHz.
7.
Berechnen Sie den komplexen Gesamtstrom folgender Schaltung sowie die jeweiligen komplexen Teilströme.
8. Berechnen Sie den komplexen Gesamtwiderstand folgender Schaltung mit f = 80 Hz.
9. Berechnen Sie den komplexen Gesamtwiderstand folgender Schaltung mit f = 270 Hz.
Grafik: grf_ea_08_etec04n.tif
10. Gegeben ist folgende Schaltung:
a) Die Schaltung liegt an einer Spannungsquelle mit U = 20 V/f = 750 Hz. Berechnen Sie den kapazitiven Blindwiderstand der Schaltung.
b) Wie groß müsste eine Induktivität L sein, wenn sie betragsmäßig den gleich großen Widerstand wie die Kapazität C haben soll?
c) Wie groß muss dagegen L sein, wenn gemäß den Gesetzen der Reihenschaltung das Spannungsverhältnis 2:1 am induktiven Widerstand betragsmäßig abfallen soll?
11. Gegeben ist folgende Formel einer Schaltung:
Zges.=24 Ω+j14 Ω
a) Verhält sich die Schaltung ohmsch-induktiv oder ohmsch-kapazitiv? Warum?
b) Der Gesamtwiderstand liegt an 23 V/65 Hz. Wie groß ist der Blindwiderstand X der Schaltung? Stellen Sie das Ergebnis der Impedanz in Eulerform dar.
c) Ermitteln Sie alle Leistungsarten, indem Sie die Scheinleistung über den Gesamtstrom und der Gesamtspannung berechnen und das Ergebnis in Komponentenform darstellen.
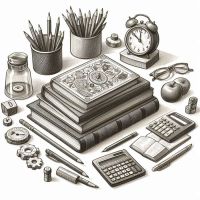 2.00
2.00
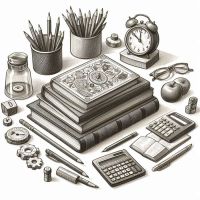 2.00
2.00
 Bewertungen
Bewertungen
 Benötigst Du Hilfe?
Benötigst Du Hilfe?
 Was ist StudyAid.de?
Was ist StudyAid.de?
 Rechtliches
Rechtliches
 Mehr von Der_Buchmacher
Mehr von Der_Buchmacher


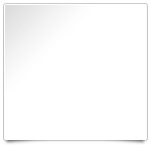;)